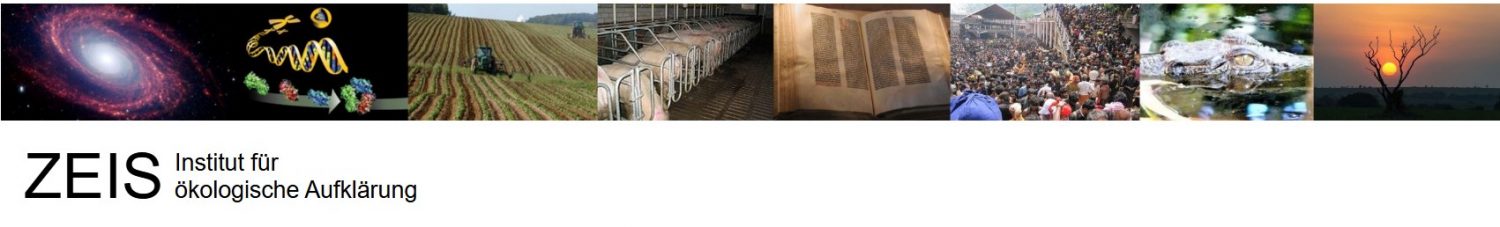Warum das beobachtbare Universum wahrscheinlich von Ökosystemen mit gleichen Naturgesetzen durchzogen ist

In den Darlegungen des ZEIS Institutes für ökologische Aufklärung steht eine Struktur physikalischer Naturgesetze im Mittelpunkt, die das irdische Ökosystem ordnen. In der folgenden vierteiligen Reflexion werden Gründe für die Annahme beleuchtet, dass es sich dabei nicht um eine Besonderheit innerhalb des beobachtbaren Universums handelt. Mit hoher Wahrscheinlichkeit ist dieser Raum von einer großen Vielzahl an Ökosystemen durchzogen, die ortsunabhängig auf dem Element Kohlenstoff basieren und von den genau gleichen Naturgesetzen geordnet werden, wie das Ökosystem des Planeten Erde.
Teil 1: Einleitung und zusammenfassendes Abstrakt
Als Ausgangspunkt der jetzigen Einleitung sollen die folgenden Fragestellungen dienen, deren Antworten dann in den weiteren Teilen mit aufbauenden Folgefragen vertieft werden:
- Warum werden die im irdischen Ökosystem beobachteten physikalischen Regelmäßigkeiten als „Naturgesetze“ bezeichnet, wo sie doch aktuell für uns nur auf dem Planeten Erde nachweisbar sind und wir darüber hinaus kein Leben an anderen Orten kennen?
- Ist das irdische Leben an sich nicht bereits eine seltene oder gar einmalige Besonderheit im beobachtbaren Universum?
- Und warum sollte Leben an anderen Orten des beobachtbaren Universums, falls vorhanden, überhaupt jegliche Parallelen und Ähnlichkeiten zu dem auf der Erde aufweisen?
Vor der detaillierten Beantwortung hier zunächst eine Zusammenfassung derselben:
ZUSAMMENFASSUNG:
Durch Kombinationen von Erkenntnisständen verschiedener naturwissenschaftlicher Disziplinen wird indirekt ersichtlich, dass Systeme lebendiger Materie (Ökosysteme) im beobachtbaren Universum mit hoher Wahrscheinlichkeit eine regelmäßige und sehr häufige Erscheinung sind.
Dabei spielt das Element Kohlenstoff mit seinen einzigartigen Eigenschaften zu potenziell unbegrenzten Kettenbildungen und den unter allen Elemente mit weitem Abstand höchsten Verbindungsfähigkeiten mit anderen Elementen und Molekülen eine zentrale Rolle. Kohlenstoff ist wahrscheinlich fast durchweg über das beobachtbare Universum verteilt und wahrscheinlich in weit über 99 Prozent aller Gesteinsplaneten der Galaxien enthalten.
Eckpunkte der Lebensentstehung können durch Erkenntnisse der chemischen Wissenschaften nachvollzogen werden. Dazu gehören Eigenschaften von Molekülen wie die Selbstreplikation [1] und dynamische Selbststabilisierung sowie experimentelle Nachweise zu Bildungen organischer Lebensbausteine wie Aminosäuren und Fettsäuren aus freien Elementen und Molekülen – jeweils unter Beteiligung von Kohlenstoff.
Somit lässt sich annehmen, dass auf Gesteinsplaneten und Gesteinsmonden bei Vorhandensein von genügend Kohlenstoff, Phosphor, einigen weiteren Elementen sowie flüssigem Wasser und ausreichend Zeit und Energie, Leben wahrscheinlich automatisch entsteht, weil das quantitativ unbegrenzte „Trial and Error“ der Kohlenstoff-Verbindungen unausweichlich in Richtung zunehmender Selbststabilisierung und Selbstreplikation der Ergebnisse führen muss. Sowohl zelluläre Gebilde als auch Erbgut sind jeweils als mechanische Optima nachvollziehbare und möglicherweise alternativlose Ergebnisse, ebenso wie die anschließende Entstehung eines wachsenden Geflechtes verschiedener Lebensformen.
Die in den Genomen gespeicherten Informationen und die Organismen insgesamt müssten dabei im Laufe vieler Millionen und Milliarden Jahre (Äquivalent in Erdjahren) so hohe Grade der Komplexität erreichen, dass die auf der Erde nachweisbaren, auf unbeherrschbar hoher Komplexität beruhenden ökologischen Gesetzmäßigkeiten stets gleich wirken. Dazu gehört, dass zwischen Spezies jegliche – nachhaltige – Lenkung der Evolution zum vorrangigen Nutzen der manipulierenden Seite ausgeschlossen ist. In der Folge sind auch Verhältnisse dauerhafter Kontrolle unmöglich. Ansetzende Abweichungen enden zügig in evolutionären Sackgassen.
Dies alles muss ortsunabhängig und ausnahmslos im gesamten beobachtbaren Universum gelten, da die durch die Eigenschaften des Kohlenstoffes gegen unendlich divergierenden, dadurch von außen nicht beherrschbaren Komplexitäten ein grundlegender physikalischer Parameter von Leben sind. Chemische Wechselwirkungen unterhalb solcher Komplexitäten könnten logische Minimaldefinitionen von Leben nicht erfüllen. Die Erde trägt vermutlich ein gut ausgebildetes, aber funktional typisches Ökosystem, in dem sich diese physikalischen Naturgesetze detailliert beobachten lassen.
Zur Sortierung noch eine kurze Erinnerung an die drei hauptsächlichen Wege zum Nachweis der im irdischen Ökosystem erkennbaren und vermutlich in allen kohlenstoffbasierten Ökosystemen wirkenden Gesetzmäßigkeiten:
Im gesamten irdischen Ökosystem (abseits menschlicher Einflüsse) existiert – trotz vielfältiger theoretischer Möglichkeiten – kein empirisch belastbar beschriebenes Beispiel einer Wechselwirkung zwischen verschiedenen Spezies mit nachhaltig funktionierender gegenseitiger Manipulation von Erblinien oder dauerhafter Kontrolle. Vermeintliche akademische Gegenbeweise sind immer fehlerhaft und lassen sich entkräften. Dies ist unabhängig davon, ob Mikroorganismen, Pflanzen, Tiere oder auch von Wirtszellen abhängige Viren beteiligt sind. Da mehrere Millionen Spezies samt Wechselwirkungen beschrieben wurden, ergibt sich ein empirischer Nachweis im Ausschlussverfahren.
Die der Unbeherrschbarkeit im Sinne der Unmöglichkeit gegenseitiger evolutionärer Manipulation und dauerhafter Kontrolle zwischen Spezies zugrunde liegenden, weit gegen unendlich strebenden Höhen der Komplexität lassen sich zudem durch mathematische Evaluation der Anzahl der Kombinationsmöglichkeiten innerhalb aller Genome im irdischen Ökosystem indirekt erkennbar machen. Diese Zahlen liegen schon bei den kleinsten Genomen um ein sehr großes Vielfaches über der von Astrophysikern geschätzten Zahl aller Elementarteilchen und Atome des gesamten beobachtbaren Universums.
Direkte Nachweismöglichkeiten bieten die vom Menschen ab der Neolithischen Revolution zu seinem vorrangigen Nutzen züchterisch manipulierten und kontrollierten „Nutzpflanzen“ und „Nutztiere“. Praktisch alle Organismen der betroffenen Erblinien sind nach einer vorangegangenen Entwicklungsgeschichte von zumindest mehreren hundert Millionen Jahren innerhalb von dagegen in evolutionären Maßstäben verschwindend kleinen Zeiträumen von einigen Jahrtausenden stark genetisch erodiert und degeneriert und meist ohne zunehmende künstliche Unterstützung nicht mehr lebensfähig (Schema der evolutionären Sackgasse).
In den nun folgenden drei Teilen geht es um ausführlichere Beantwortungen der oben aufgeführten Grundfragen. Sie sind so angepasst, dass sie allgemein verständlich sein sollen. Einige Stufen der Reflexion werden über die angekündigten Folgefragen eingeleitet. Das irdische Ökosystem wird als Referenz dienen. Auf der Erde stehen vielfältige Möglichkeiten zur Beobachtung von Zusammenhängen zur Verfügung, die in verschiedener Weise auf das gesamte beobachtbare Universum übertragbar sind.
Dass sich in den veröffentlichten Erkenntnisständen zu der Entstehungsgeschichte des irdischen Lebens sowie den Gegebenheiten außerhalb unseres Sonnensystems aufgrund der schwierigen Ausgangslage (große Zeiträume und Entfernungen) mitunter auch in akademischen Beschreibungen größere hypothetische Anteile befinden, wurde berücksichtigt. Gänzlich ausgeklammert blieben solche der zahlreichen auch innerhalb den etablierten Naturwissenschaften vorgetragenen Konzepte, die als bloße Ideen ohne empirische Grundlagen erkennbar sind. Dazu gehören beispielsweise Hypothesen zu Lebewesen auf Basis anderer Elemente als Kohlenstoff, zu speziellen Organismen in flüssigem Magma, „Strahlungsorganismen“ und einiges mehr.
Die Sortierung der Informationen orientiert sich unter anderem an fundierten Beschreibungen aus den jeweiligen naturwissenschaftlichen Disziplinen, fachkundigen Mehrheitsmeinungen und eigenen logischen Schlussfolgerungen.
Teil 2: Das überschaubare Sortiment der chemischen Elemente im beobachtbaren Universum und die Besonderheiten des Kohlenstoffes
Zur Annäherung an ein Verständnis des Lebens und seiner Entstehung sind die Grundlagen der Chemie zu betrachten. Dadurch werden zügig erste wahrscheinliche Parallelen und Ähnlichkeiten von Ökosystemen im gesamten beobachtbaren Universum indirekt ersichtlich. Und dies reicht anschließend bis zu logischen Antworten auf Basisfragen rund um die Neuentstehung und Häufigkeit von Leben.
Es gilt als weithin unstrittig, dass die Materie des gesamten beobachtbaren Universums aus einem überschaubaren Sortiment stets gleicher chemischer Elemente besteht. Diese lassen sich insbesondere durch die Anzahl der positiv geladenen Protonen in ihren Atomkernen unterscheiden. Die Anzahl ist in den chemischen Wissenschaften die Basis des Periodensystems, wobei 1 (nur ein Proton im Atomkern) für das weitaus häufigste, älteste und leichteste „Urelement“ steht, nämlich der Wasserstoff.
Da im Gefüge aus Raum und Zeit die Zeit mit zunehmender Nähe zu Materie langsamer vergeht (Raumzeitkrümmung, Gravitation), zogen sich annähernde Wasserstoffatome seit vermutlich rund 14 Milliarden Jahren zu annähernd runden Anhäufungen zusammen, die Sterne. In deren Zentren sind die stets nach innen gerichteten kumulierten Gravitationsdrücke so groß, dass nahe des Mittelpunktes befindliche Wasserstoffatome quasi zerquetschen und verschmelzen (Kernfusion). Dadurch formieren sich zunächst Atome mit zwei Protonen (Helium). In späteren Lebensphasen der Sterne bilden sich in weiteren Kernfusionsprozessen unter Beteiligung der Helium-Atome weitere Elemente mit mehr als zwei Protonen im Atomkern. Die Wasserstoff-Sterne sind also die Generatoren der anderen chemischen Elemente des beobachtbaren Universums.
Aktuell sind die Elemente des beobachtbaren Universums lückenlos von 1 (1 Proton) bis 118 (118 Protonen) bekannt. Dabei sind Atome mit mehr als 92 Protonen (Uran) aber für die Betrachtung der regelmäßigen Abläufe in lebendigen Ökosystemen nicht mehr direkt relevant. Wegen der hohen Anzahl der Protonen sind sie so schwer, dass sie nur relativ wenig Stabilität besitzen und auf der Erde sowie wahrscheinlich auch auf anderen Gesteinsplaneten oder Gesteinsmonden (Körper aus festen Materialien, anders als Gasplaneten und Gasmonde) schnell zerfallen. In Spuren (ohne materielle Relevanz) wurden auf der Erde nur noch Neptunium (93) und Plutonium (94) nachgewiesen. Das schwerste bekannte Element Oganesson (118) wurde bisher nur experimentell erzeugt und dadurch nachgewiesen, es zerfällt auf der Erde annähernd unmittelbar.
Somit besteht alle Materie der Erde sowie wahrscheinlich auch die anderer Gesteinsplaneten und Gesteinsmonde des gesamten beobachtbaren Universums mit seinen vermutlich rund 200 Milliarden Galaxien aus gerade mal jeweils höchstens 92 chemischen Elementen und diese sind in unseren Wissenschaften recht gut erforscht. Die Reihe der bekannten Elemente beginnt im Periodensystem also mit dem Wasserstoff (1 Proton) und setzt sich mit dem zweithäufigsten Helium (2) fort. Dann geht es weiter mit Lithium (3), Beryllium (4), Bor (5), Kohlenstoff (6), Stickstoff (7), Sauerstoff (8), Fluor (9), Neon (10), Natrium (11), Magnesium (12), Aluminium (13), Silizium (14) und so fort bis eben zur Zahl 118.
Innerhalb dieses Sortimentes der Elemente gibt es eines, welches mit großem Abstand als das am besten geeignete, wahrscheinlich sogar einzig mögliche Grundelement für lebendige Materie gilt. Und dies ist der Kohlenstoff (6). In der relativen Masse macht er gegenüber Wasserstoff und Helium nur einen winzigen Bruchteil der Materie des beobachtbaren Universums aus. Da er aber, so wie andere Elemente, in den späten Lebensphasen der meisten Sterne mit mittlerer und hoher Masse produziert und etwa von sich langsam auflösenden Roten Riesen abgesondert sowie bei großen Explosionen sehr massereicher Sterne (Supernovae) sogar bis weit über die Grenzen ganzer Galaxien hinausgeschleudert wird, dürfte Kohlenstoff sowie andere Elemente in großen Teilen des beobachtbaren Universums vorhanden sein. Viel davon ist noch freier Staub, so wie zunächst alle von den Sternen ausgestoßenen Elemente. Aber wenn sich im Raum aus freiem Staub durch die Gravitation neue Planetensysteme bilden, ist wahrscheinlich meist schon von vorneherein quasi eine Brise Kohlenstoff dabei.
Die exklusiven Besonderheiten der Atome des Elementes Kohlenstoff sind ebenfalls – in ihren Grundzügen – recht gut erforscht. Sie liegen in ansonsten beispiellosen Fähigkeiten zur Kettenbildung, Bindung mit anderen Elementen, aber auch zur Trennung. Je nach Auslegung sind mindestens 20 Millionen, nach einigen Schätzungen gar bis zu 100 Millionen verschiedene Verbindungen zwischen Elementen und Molekülen unter Beteiligung des Elementes Kohlenstoff bekannt – alle anderen bekannten chemischen Verbindungen ohne Beteiligung von Kohlenstoff bringen es zusammengerechnet gerade mal auf rund 200.000 (Unter Ausklammerung des Urelementes Wasserstoff, da auch in Kohlenstoffverbindungen meistens vorhanden). Hinsichtlich den Kettenbildungen der Kohlenstoffatome mit sich selbst gibt es sogar überhaupt keine erkennbare Obergrenze. Und das betrifft nicht nur die Längen der Ketten, sondern auch die entstehenden Formen, die somit praktisch grenzenlos variabel sind. Sie können beispielsweise ringförmig, verzweigt, rund, oder netzartig sein.
Also ist bei Beteiligung von Kohlenstoff das Potenzial einer wahrscheinlich unbegrenzt hohen Komplexität der chemischen Gebilde gegeben, welche so kein anderes Element bietet. In früheren Jahrzehnten war die These populär, nach der alternativ etwa auch Silizium eine ähnliche Rolle spielen könnte. Mittlerweile sind die Vorteile des Kohlenstoffes und die wahrscheinlich zu geringen Fähigkeiten des Siliziums zur Bildung flexibler Verbindungen und Reihungen so deutlich geworden, dass die Silizium-These nur noch relativ wenig Beachtung findet.
Mit den einzigartigen Fähigkeiten des Elementes Kohlenstoff liegt bereits eine wichtige Teilantwort auf die Frage nach Parallelen und Ähnlichkeiten von Leben an verschiedenen Orten des beobachtbaren Universums vor: Demnach basieren lebende Systeme gegebenenfalls so wie auf der Erde wahrscheinlich stets auf diesem Element, unabhängig davon, wo sie entstehen und existieren.
Teil 3: Die vermutlichen Automatismen der Lebensentstehung und die gegen unendlich strebende Komplexität als zentraler Parameter
In Teil 2 wurden rund um den Kohlenstoff einige wahrscheinliche Parallelen indirekt ersichtlich, die auf gegebenenfalls vorhandene Ökosysteme im gesamten beobachtbaren Universum zutreffen müssten. Weitere wahrscheinliche Parallelen lassen sich darauf aufbauend über eine Reflexion rund um die Frage der Neuentstehung von Leben identifizieren.
Eine geeignete Schlüsselfrage zur Annäherung lautet: Wenn, so wie es für die frühe Erde vermutet wird, neben ausreichend Kohlenstoff auch einige weitere passende geologische und materielle Voraussetzungen sowie genügend Zeit und Energie gegeben sind, und derweil keine größeren Störfaktoren wie etwa Kollisionen mit anderen großen Körpern auftreten, könnte es dann überhaupt sein, dass trotzdem kein Leben entsteht? Hätte es also sein können, dass auf der Erde unter genau den damals gegebenen Bedingungen kein Leben entstanden wäre?
Die mit hoher Wahrscheinlichkeit korrekte Antwort ist: Nein. Denn warum sollten die Kohlenstoffatome, angetrieben von der ausreichenden Energie, nicht automatisch so viele – sehr weit abseits unseres Vorstellungsvermögens viele – Kombinationen und Verbindungen „ausprobieren“, bis sich in diesem „Trial and Error“ unweigerlich zunehmend sich selbst stabilisierende und dabei auch selbstreplizierende – in diesem Sinne temporär optimale und sich stetig weiter optimierende – Strukturen bilden?
Phänomene der Selbstreplizierung [1] und Selbststabilisierung von chemischen Verbindungen sind auch schon weit unterhalb solcher Strukturen beschrieben, welche die Minimaldefinitionen von Leben erfüllen. Dazu gehören Selbstreplikationen, in denen sich chemische Verbindungen durch Rückkopplung selbst kopieren, so dass es zur Zunahme der gleichen Verbindungen in der Umgebung kommt. Und das reicht bis zu dynamischen Selbststabilisierungen, in denen bereits Stoffe innerhalb fest etablierter Strukturen umgesetzt werden. Wird dies in Kombination gesetzt mit den seit den 1950er Jahren (Miller-Urey-Experiment) vielfach experimentell und reproduzierbar erzeugten Bildungen von Lebensbausteinen wie Aminosäuren, Fettsäuren, Zuckerstoffen aus freien Molekülen – mithin wichtige Grundmaterialien etwa für Zellhüllen und RNA-Strukturen –, so entsteht bereits ein schlüssiger Rahmen zur Begründung einer bisher noch nicht vorhandenen allgemeinen Theorie zur Lebensentstehung.
Offene Fragen, die einer solchen allgemeinen Theorie entgegenstehen zu scheinen, sind insofern unerheblich, als dass sie nachrangige Details der Abläufe einer Lebensentstehung betreffen. Viele dieser Details sind also zwar nicht verstanden. Aber ob nun beispielsweise einfache RNA-Moleküle zuerst aufkamen oder einfache Zellstrukturen, ist nachrangig. Wesentlich ist hingegen die durch die Eigenschaften des Kohlenstoffes gegen unendlich strebende Komplexität des Geschehens. Diese Komplexität ist als wesentlicher Parameter zu betrachten, ähnlich wie es bei Fragen der materiellen Zusammenhänge (auch) unterhalb lebendiger Systeme etwa mit Lichtgeschwindigkeit und Raumzeitkrümmung getan wird.
Dass es bisher keine anerkannte einheitliche Theorie zur physikalischen Lebensentstehung aus unbelebter Materie heraus gibt, dürfte also weder an fehlenden Potentialen der Naturwissenschaften noch an zu geringen Erkenntnisständen liegen. Sondern eine bestimmte Hürde im kollektiven Weltbild der Menschen blockiert die entscheidenden Schlussfolgerungen: Da der Prozess der Lebensentstehung unweigerlich mit weit gegen unendlich strebender und folglich unbeherrschbar hoher Komplexität einhergeht, würde deren Anerkennung sogleich die im nachhaltigen Sinne absolute Unbeherrschbarkeit anderer Organismen durch den aktuellen Menschen aufdecken und in diesem Sinne dessen Existenzgrundlage der Agrarmethodik als disfunktional erkennbar werden lassen.
Es ist im kollektiven Konsens nicht erwünscht, dies zu tun. Stattdessen werden historisch und bis heute vielerlei Verdrehungen und Unterdrückungen produziert, um die unbeherrschbare Komplexität ausblenden zu können. Diese beginnen etwa mit religiösen Konzepten angeblicher göttlicher Anweisungen zur Beherrschung anderer Organismen und ziehen sich über philosophische Ideen exklusiver menschlicher Freiheitszustände bis hinein in Verzerrungen grundlegender Interpretationen in den aktuellen Naturwissenschaften.
Aktuell lässt sich die Funktionsweise dieser unterbewussten psychologischen Mechanismen an scheinbar zufälligen semantischen Fehlern erkennen. So wird die unbeherrschbare Komplexität der über viele Millionen Jahre der Evolution in den Genomen von Lebewesen angehäuften und abgespeicherten, in sich verwobenen Informationen durch öffentliche Falschmeldungen überdeckt, nach denen der Mensch ganze Genome „entschlüsseln“ könne. Vertauscht wird hier der Begriff der „Entschlüsselung“, welcher die Erkennung aller abgespeicherten Informationen bedingen würde, mit dem eigentlich korrekten Begriff „Sequenzierung“. Dieser bezeichnet aber nur das bloße Auslesen der Reihenfolgen der Nukleotide im Genom ohne Bezug zur Entschlüsselung der darin liegenden Informationen. Und viel mehr ist auch nicht passiert. Mit der angeblichen Entschlüsselung ganzer Genome wird also erneut eine (in der Realität ausgeschlossene) Beherrschbarkeit der belebten Natur durch den Menschen suggeriert. Folgende Abbildung zeigt Beispiele der vermeintlich zufälligen semantischen Fehler durch etablierte Forschungseinrichtungen:
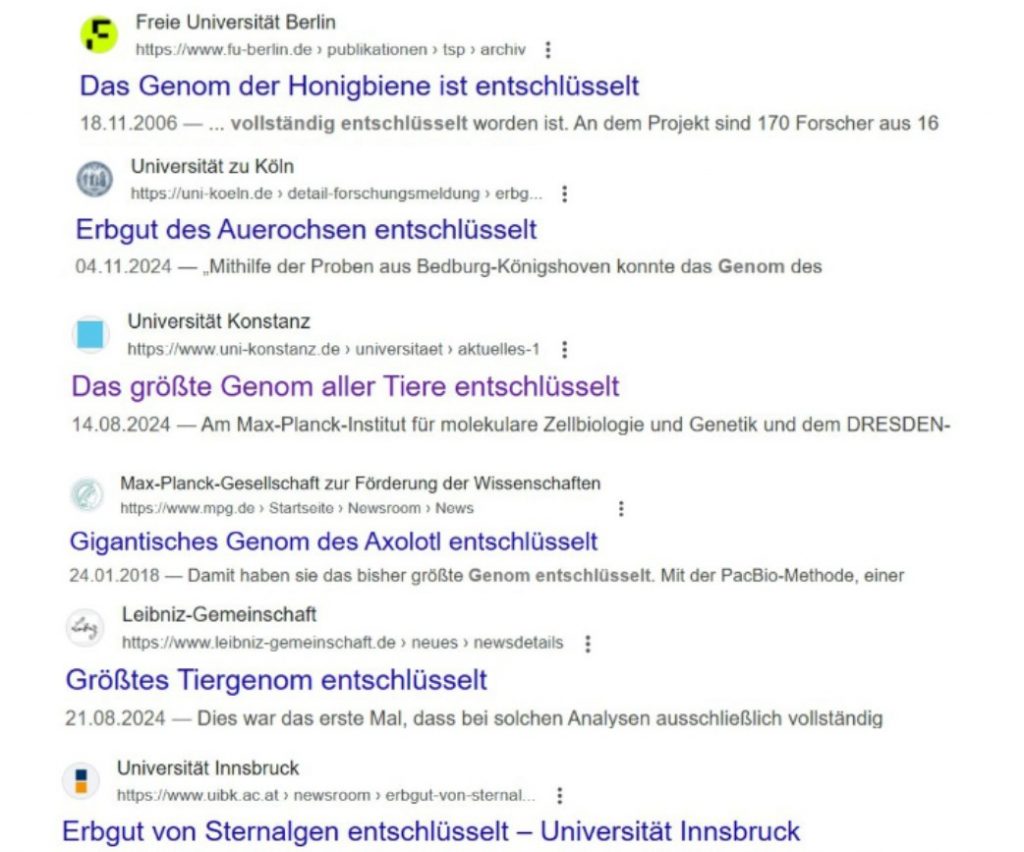
Zur beispielhaften Veranschaulichung der nicht entschlüsselbaren Komplexität eignet sich die Forschung an dem die Krankheit AIDS auslösenden HIV-Virus: An Dutzenden Forschungseinrichtungen auf fünf Kontinenten arbeiten tausende Wissenschaftler seit Jahrzehnten an diesem winzigen Parasiten, ohne dass Ansätze einer echten Entschlüsselung entstanden sind. Es gibt Erfolge in Form symptomatischer Behandlungen der Krankheit. Aber das Volumen der Fragen rund um die genetische Organisation des Virus hat sich im Laufe der Jahre nicht reduziert, sondern stark aufgeweitet. Dabei ist dessen Genom gerade mal rund 9700 Nukleotid-Moleküle lang. Die kürzeste DNA von Organismen mit Stoffwechsel liegt bereits weit im fünfstelligen Bereich. Die Komplexitäten des HIV-Virus sowie die aller anderen Viren und Organismen liegen viel zu hoch, als dass sie jemals durch den Menschen entschlüsselt werden könnten. Dabei spielt es keine Rolle, wie weit sich rechnerische Kapazitäten oder Künstliche Intelligenz noch entwickeln mögen.
Zusammenfassend eröffnet also das Begreifen der Potenziale eines grenzenlos gegen unendlich strebend komplexen „Gewusels“ und „Ausprobierens“ durch die Kohlenstoffatome mit weiteren vorhandenen Elementen über viele Millionen Jahre das Verständnis dafür, dass dies wahrscheinlich beim Vorhandensein einiger Voraussetzungen nicht anders ausgehen kann, als dass sich fortschreitende dynamische Selbststabilisierungen mit der Tendenz zu zunehmend komplexen, aufeinander aufbauenden Strukturen bilden, die bei passenden Bedingungen bis in solche reichen, die wie Leben funktionieren. Diese chemischen Prozesse verlaufen wahrscheinlich fließend, ohne dass es einen plötzlichen Sprung von unbelebter zu belebter Materie gibt.
Hinsichtlich der Schritte nach der Entstehung komplexer organischer Moleküle gelten Strukturen im Sinne von organischen Schutzräumen (Zellen) als Favorit. Diese Erklärung ist schlüssig, weil sich das Trial and Error darin weitaus besser fortzusetzen vermag als außerhalb, sodass sich die Komplexität der dynamischen Selbststabilisierung – oder auch: „Selbstoptimierung“ – entsprechend weiter erhöhen kann und ohne große Störfaktoren automatisch wird. Ohne Schutzräume wäre diese Steigerung so wahrscheinlich nicht möglich, weil verschiedene Umwelteinflüsse den Prozess dafür zu stark behindern oder zu häufig unterbrechen würden. Auch irdische Viren ohne Zellhülle benötigen für ihre nachhaltige Existenz die Zellen ihrer Wirtsorganismen.
Die Strukturen entsprechend den Zellen scheinen also logische Ergebnisse des fortschreitenden Prozesses der Selbststabilisierung zu sein. Nach alternativen Vorschlägen könnte auch poröses Gestein passende Schutzräume bieten. Diese hätten allerdings einige grundlegende Nachteile gegenüber eigenen organischen Strukturen.
Es ist nicht unwahrscheinlich, dass die auf der Erde beobachtbaren zellulären Strukturen wie ein Optimum sind, auf das sich der Prozess einer voranschreitenden Lebensentwicklung einpendelt. Und das lässt sich auch für viele weitere Ergebnisse annehmen. So gilt beispielsweise der „genetische Code“, der bei der Übersetzung der Nukleotidsequenzen von RNA-Einzelsträngen in Aminosäuresequenzen von Proteinen fungiert, bei annähernd allen Lebensformen als gleich. Die evolutionäre Logik von automatischen Optimierungsprozessen mit weit gegen unendlich strebenden Potenzialen der Komplexität führt mit nicht geringer Wahrscheinlichkeit zu immer annähernd gleichen Ergebnissen.
Teil 4: Mit hoher Wahrscheinlichkeit ist das Universum von einer großen Vielzahl an Ökosystemen mit gleichen Naturgesetzen durchzogen
Nun ist eine Einschätzung dazu offen, wie häufig es denn abseits unseres Planeten Erde im beobachtbaren Universum Leben geben könnte. Da die Entstehung als automatischer Prozess angenommen werden kann, lässt sich die Frage auswechseln in jene nach der Häufigkeit von Gesteinsplaneten und Gesteinsmonden, auf denen die dafür notwendigen Voraussetzungen gegeben sind. Eine Basis zur Abschätzung bietet unser Sonnensystem.
Die Sonne selbst ist in der Sternklasse der Gelben Zwerge hinsichtlich Größe, Helligkeit und Wärme wie ein durchschnittlicher Standartstern. Die Zahl der Planeten lässt sich auf Grundlage der Daten von Teleskopen zumindest in unserer Galaxie, der Milchstraße, als ebenfalls annähernd durchschnittlich annehmen.
Für die Lebensentstehung ist wahrscheinlich flüssiges Wasser mit großen Tiefen am günstigsten. Ein Grund liegt im Schutz vor kosmischen Strahlungen, durch welche die Prozesse der Bildung zunehmend komplexer und sich weiter stabilisierender Strukturen gestört werden könnten. Also wäre eine nächste Frage: Wie oft gab oder gibt es auf Gesteinsplaneten und Gesteinsmonden in unserem – durchschnittlichen und somit beispielhaften – Planetensystem flüssiges Wasser mit großen Tiefen? Die Antwort auf der Grundlage der Daten von Teleskopen und Sonden ist: häufig bis sehr häufig. Es gilt als nachgewiesen, dass eine Reihe jener Gesteinsmonde, die um die Gasplaneten Jupiter und Saturn kreisen, aktuell unter ihren Eiskrusten große Ozeane flüssigen Wassers tragen. Diese Meere enthalten demnach teilweise flüssige Wassermassen, die vielfach größer sind als alles Wasser der Erde. Sie sind wahrscheinlich schon sehr alt und bis zu über 100 Kilometer tief. Stabile Energie ist sicher vorhanden – sonst wären sie unterhalb der Eispanzer nicht flüssig. [2]
Wie ernsthaft die Vermutungen sind, dass sich zumindest in manchen dieser Ozeane Leben und Ökosysteme befinden, wird unter anderem dadurch erkennbar, dass seit Jahrzehnten unbemannte Raumsonden zu den Monden geschickt werden. Darunter war die naturwissenschaftlich bahnbrechende Sonde Galileo, mit der erstmals flüssiges Wasser unter den Eispanzern dreier Jupitermonde (Europa, Ganymed, Kallisto) weitgehend nachgewiesen werden konnte. Aktuell sind zwei Sonden aus der EU („JUICE“, ESA) und den USA („Europa Clipper“, NASA) auf dem Weg, die Ankunft an den Monden wird für die Jahre 2030 und 2031 erwartet. In diese Projekte wurden hohe finanzielle Mittel investiert und das zentrale Ziel ist der Nachweis von außerirdischem Leben. Viele Forscher sind optimistisch, dass dies mittels der Sonden zumindest indirekt gelingen wird.
Für die Energien der Ozeane unter den Eispanzern von Gesteinsmonden oder auch Gesteinsplaneten im beobachtbaren Universum gibt es einige potenzielle Quellen. Dazu gehört die innere Restwärme der bei ihrer Entstehung heißen Körper und daraus resultierender Vulkanismus. Auch für den Planeten Erde wird überwiegend angenommen, dass die ersten Zellstrukturen in tiefen Gründen des Urozeans an vulkanischen Rauchern entstanden sind. Eine andere Hauptquelle insbesondere auf Monden sind die Gezeiten: Unter dem Einfluss der Gravitationskräfte ihrer Planeten werden die Monde stabil „durchgewalkt“, wodurch gleichmäßige Reibungswärme entsteht. Weitere potenziell stabile Energien könnten von radioaktiven Prozessen ausgehen. Und schließlich sind Kombinationen mehrerer dieser und weiterer Energiequellen möglich. Manche Astrowissenschaftler in den einschlägigen Forschungsgebieten halten es für nicht unwahrscheinlich, dass in einigen Wassermassen der Monde von Jupiter und Saturn nicht nur einzelliges Leben existiert, sondern auch wesentlich komplexere mehrzellige Organismen. [3]
Die Annahme, dass Leben in flüssigem Wasser mit hoher Wahrscheinlichkeit eine häufige Erscheinung im beobachtbaren Universum ist und dass dieses nicht an sogenannte habitable Zonen innerhalb von Planetensystemen gebunden sein muss, lässt sich also als gut begründet erachten. Denn wenn es in unserem Sonnensystem zahlreiche Gesteinsmonde gibt, die unter einer Eisdecke Ozeane aus flüssigem Wasser tragen, dann dürfte dies auch für einen Großteil anderer ähnlicher Planetensysteme gelten oder Laufe ihrer Geschichte gegolten haben. Hinsichtlich der Historie unseres Sonnensystems ist es ausweislich von verschiedenen Spuren wahrscheinlich, dass auf Planeten und Monden viele weitere Ozeane existiert haben, die im Laufe der Milliarden Jahre wieder verschwunden sind. Wasser wird mittlerweile als eine im beobachtbaren Universum sehr häufige chemische Verbindung vermutet.
Eine ausweislich zahlreicher öffentlicher Äußerungen für viele Menschen besonders interessante Frage liegt aber nun noch darin, wie oft es denn auch Leben oberhalb von Wasser, auf Landflächen und unter einer lebensfreundlichen Gasatmosphäre geben könnte – also ähnlich wie auf der Erde. Dafür dürften tatsächlich Grundvoraussetzungen Bedingung sein, die den üblichen Definitionen von habitablen Lagen ähneln. Denn als deren Haupteigenschaft wird die Möglichkeit flüssigen Oberflächenwassers angesehen. Und ohne solches ist eine erdähnliche Situation nicht logisch vorstellbar. Dieser Punkt begründete bisher eine Hauptmeinung, nach der die auf der Erde gegebenen Bedingungen doch ziemlich oder gar sehr selten sein müssten. Mittlerweile vollzieht sich aber auch dazu eine Wandlung. Sowohl die Häufigkeit von Gesteinskörpern in habitablen Lagen als auch die Wahrscheinlichkeit der Entstehung von lebensfreundlichen Atmosphären werden mittlerweile als weitaus höher eingeschätzt als noch vor wenigen Jahren. Die vermutliche Entstehungsgeschichte des Planeten Erde bietet hier wieder eine Referenz.
Nach gängiger Mehrheitsmeinung bildete sich der Planet im Rahmen der Entstehung des Sonnensystems vor etwa 4,6 Milliarden Jahren (im Äquivalent heutiger Erdjahre), als sich eine Wolke aus Staub und Gas verschiedener Elemente unter der Gravitation zusammenzog. Und bereits vor rund 3,8 Milliarden Jahren haben demnach einzellige Organismen die ersten uns bekannten fossilen Spuren gelegt, nämlich bestimmte Kalksteinformationen (Stromatolithen). [4]
Eine Gasatmosphäre gab es zu dieser Zeit auch schon. Allerdings sorgte diese bei Weitem noch nicht für ein lebensfreundliches Klima und auch ihre Bestandteile, darunter ein hoher Anteil Kohlenstoffdioxid, dürfte für Leben an der Erdoberfläche noch nicht geeignet gewesen sein. Das Leben spielte sich also wahrscheinlich zunächst über einen langen Zeitraum nur im Wasser ab. Dass sich dies später hinaus geändert hat und eine gemäßigte Atmosphäre mit signifikanten Anteilen gasförmigen Sauerstoffes entstand, war aber kein Zufall. Sondern einige der frühen Einzeller kamen in ihrer Evolution quasi auf die Idee, den in Molekülen des Kohlenstoffdioxids enthaltenen Kohlenstoff abzuspalten und sich davon zu ernähren. Da Kohlenstoffdioxid eine Verbindung von Kohlenstoff und Sauerstoff ist, blieben als Abfallprodukte freie Sauerstoffmoleküle übrig.
Dieser Prozess begann mit im Wasser gelöstem Kohlenstoffdioxid. Aber da die Methode der Kohlenstofffresser sehr erfolgreich war, breiteten diese sich schließlich in zahlreichen Spezies bis an die Wasseroberfläche aus. Und dort begannen sie auch auf den gasförmigen Anteil des begehrten Stoffes zuzugreifen. So kam es, dass insbesondere die Cyanobakterien zu einem gigantischen Generator freier Sauerstoffmoleküle wurden und damit den Weg ebneten für die heutige Atmosphäre.
Nun die nächste Frage: Hätte es eigentlich passieren können, dass unter den frühen Mikroben keine Kohlenstofffresser entstanden wären? Dies dürfte unwahrscheinlich sein, denn der Kohlenstoff ist offensichtlich als gute und stabile Nahrungsquelle geeignet. Die evolutionäre Idee ihn so zu verwenden, wird wohl ebenfalls wieder automatisch aufkommen.
Die nächste Folgefrage: Wie häufig gibt es Gesteinsplaneten oder auch Monde mit Atmosphären, die Kohlenstoffdioxid enthalten? Wie hoch deren Anteil unter allen Planeten und Monden im beobachtbaren Universum ist, lässt sich bisher mangels hinreichender Daten nicht direkt und solide abschätzen. Aber das unsrige Sonnensystem bietet auch hierzu wieder indirekte Hinweise. Gegenwärtiges Kohlenstoffdioxid wurde nämlich in den Atmosphären aller vier hiesigen Gesteinsplaneten (Erde, Mars, Merkur, Venus) und in denen von mindestens sechs Monden nachgewiesen. Auch lässt sich wieder annehmen, dass dies in der gesamten Lebensspanne unseres Sonnensystems noch viele weitere Male vorkam.
Es ist somit nicht unwahrscheinlich, dass auch Entstehungen von Atmosphären ähnlich jener der Erde während der Lebensdauer der meisten unserem Sonnensystem halbwegs ähnlichen Planetensysteme einige Male ablaufen. Auch etwa für den Planeten Mars halten einschlägige Wissenschaftler eine frühere lebensfreundliche, gemäßigte und wasserreiche Oberfläche sowie ein damaliges Ökosystem auch oberhalb der Wasserlinie für wahrscheinlich. [5]
Und noch zuletzt, die ergänzende Frage nach dem mutmaßlichen Anteil solcher Planetensysteme im beobachtbaren Universum, die Planeten in besagten habitablen Zonen tragen. Auch hierzu hat sich die Mehrheitsmeinung in den letzten Jahren und Jahrzehnten deutlich in die Richtung einer weit höheren Zahl bewegt als sie früher vermutet wurde.
Hinsichtlich erdähnlicher Gesteinsplaneten in habitablen Zonen um Sterne der Art Gelber Zwerge reichen für unsere Galaxie die Schätzungen aktueller und anerkannter Fachstudien mit Hochrechnungen von 300 Millionen (NASA, 2020) bis sechs Milliarden (Bryson et al., 2021). Als wichtigster Parameter der Habitabilität wurde in den Schätzungen weiter die potenzielle Möglichkeit von stabil flüssigem Oberflächenwasser definiert. Solche möglichen Lebensräume unter den Eispanzern von Monden wie jene um Jupiter oder Saturn spielten also keine Rolle. Und auch blieben die Planeten rund um andere Arten von Sternen, wie die besonders häufig vorkommenden Roten Zwerge, ebenfalls unberücksichtigt. Derweil werden den letztgenannten mitunter hohe Potenziale zugeschrieben, teilweise wird ein Anteil von bis zu 50 Prozent der Roten Zwerge vermutet, in deren Gravitationsfeldern erdgroße Gesteinsplaneten in habitablen Zonen existieren könnten (Dressing & Charbonneau, 2015).
Es ließen sich noch viele weitere Erkenntnisse reflektieren, die in ihrer Kombination in Richtung des logischen Schlusses führen, nach dem das beobachtbare Universum tatsächlich von Leben durchzogen sein muss. Ein überwiegender Anteil der Ökosysteme wird sich in flüssigem Wasser befinden. Aber auch Leben, das sich zusätzlich oberhalb der Wasserlinie unter geeigneten Gasatmosphären abspielt, dürfte häufig sein und möglicherweise in einem Großteil der Planetensysteme des beobachtbaren Universums zeitweise existiert haben oder noch existieren.
Die Annahme, dass das irdische Leben etwas Außergewöhnliches und Seltenes sei, ähnelt wahrscheinlich einer Situation, in der man ein feststehendes Mikroskop auf einen Waldboden richtet, dabei zufällig genau eine einzelne Mikrobe fokussiert und dann denkt: „Was für ein unfassbarer Zufall, dass wir die hier entdeckt haben, wo es doch so etwas bestimmt nur ganz selten gibt oder sogar einmalig ist!“. Dass der Waldboden durchzogen ist von fast unzählbar vielen Mikroben, lässt sich derweil nicht direkt erkennen. Der wesentliche Grund dafür, dass bisher kein empirischer Nachweis von Leben abseits der Erde erbracht wurde, ist offensichtlich die Größe des Universums mit räumlichen Entfernungen, die ein beträchtliches Hindernis bei der Beobachtung außerhalb unseres Planeten sind.
Wir im ZEIS Institut für ökologische Aufklärung gehen davon aus, dass sich innerhalb der kommenden zehn Jahre die Indizien für außerirdischen Lebens stark verdichten werden oder solches sogar direkt nachgewiesen wird. Das könnte etwa durch Untersuchungen mittels der erwähnten Sonden oder indirekt über verfeinerte teleskopbasierte Spektralanalysen geschehen. Allerdings wird dies alleine den bisher auch die naturwissenschaftliche Erforschung der fundamentalen physikalischen Naturgesetze in belebter Materie blockierenden Verdrängungskomplex noch nicht aufbrechen. Dafür müssten zunächst anhand des irdischen Lebens die unbeherrschbar hohen Komplexitäten aller Genome und Organsimen eines ökologischen Gefüges anerkannt und akzeptiert werden. Dies ist, wie ausgeführt, der eigentliche Schlüssel zum Verständnis der eigenen physikalischen Naturgesetze in ökologischen Gefügen.
FAZIT:
Ein direkter Nachweis dazu, dass Leben im beobachtbaren Universum eine regelmäßige Erscheinung ist, lässt sich derzeit nicht führen. Da aber bereits viele physikalische und chemische Grundlagen samt ihren Gesetzmäßigkeiten als dortige Regelmäßigkeiten nachgewiesen sind, kann dies mittels darauf aufbauenden logischen Folgerungen als sehr wahrscheinlich angenommen werden. Die Eigenschaften des Elementes Kohlenstoff lassen im Grunde keinen anderen Schluss zu, als dass sie in Kombination mit einigen Voraussetzungen automatisch in die Entstehung belebter Materie münden müssen. Kohlenstoff ist ein weit verbreitetes Element. Sollte es so sein, dass kohlenstoffbasiertes Leben im beobachtbaren Universum eine regelmäßige und sehr häufige Erscheinung ist, dann stehen die in den Sektionen „Evolution“ und „Freiheit“ dargelegten physikalischen Naturgesetze und Regelmäßigkeiten in einer Reihe mit solchen etwa rund um Gravitation, Mechanik oder Elektromagnetismus. Denn die unbeherrschbar hohe Komplexität wäre in diesem Raum ortsunabhängig immer der zentrale Parameter belebter Materie.
[1] https://cordis.europa.eu/article/id/202465-selfreplicating-molecules-provide-clues-to-how-life-may-have-begun/de
[2] https://science.orf.at/v2/stories/2935957/
[3] Jonah Peter et al. (Harvard University, Nature Astronomy, 2023) “Detection of hydrogen cyanide and other nitriles in the plume of Enceladus”
[4] https://www.phoenix.de/geschichte–des–lebens–a–140870.html
[5] https://www.br.de/nachrichten/wissen/war-der-mars-einst-bewohnbar-nasa-rover-liefert-neue-hinweise,UjH2cWR